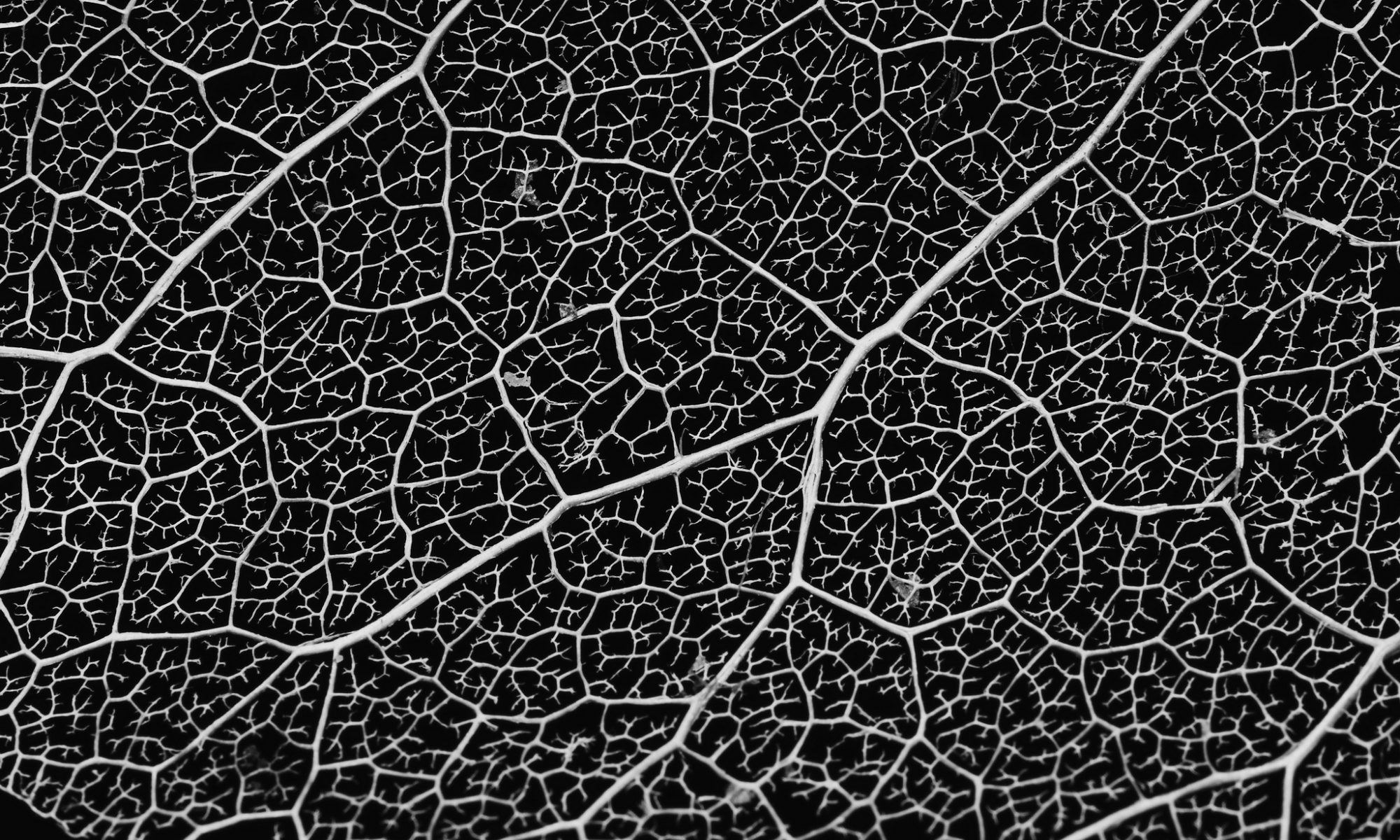„Analog unterwegs zu sein, ist heutzutage ein Luxus, den sich keiner mehr gönnt.“ #Vielfaltswerkstatt #Digitalisierung #ZukunftderArbeit— Charta der Vielfalt (@ChartaVielfalt) 6. Juli 2016
Vielleicht lese ich diesen Tweet falsch, aber wenn er das Analoge dem Digitalen als eine Alternative gegenüberstellt, bei der man sich nur zwischen dem Einen oder dem Anderen entscheiden kann, dann steckt dahinter eine digitale Logik. Eine Logik von Nullen und Einsen, von Ein und Aus, von Ja oder Nein. (also steckt dahinter definitiv kein Jein). (Ausschließliches) Analogdenken ist dann digital.
Paul Watzlawick hat diese Logik mal schön in „Vom Schlechten des Guten: Oder Hekates Lösungen“ ausgeführt. Er schildert dort nicht nur, dass immer mehr das Gleichen Guten nicht zwingend weiterhin zu etwas Gutem führt, sondern beschreibt auch das Problem des „tertium non datur“. Diese Logik erlaubt kein drittes, es ist etwas oder es ist nicht (kurz gesagt). Das ist digital. Bei Watzlawick ist das schön dargestellt am Beispiel eines Schildes auf einem Rasen, auf dem Schild steht „Rasen betreten verboten“. Übliche Schlussfolgerung: Ich kann mich an das Gebot halten oder nicht. Ja oder Nein. Aber: Ich könnte auch einfach feststellen, dass der Rasen schön ist (sagt Watzlawick). Oder ich könnte – so wie die Aktionskünstlerin (korrekte Bezeichnung?) Barbara, das Schild verschönern. Das wäre ein drittes und viertes mögliches Verhalten zur Situation.
Vom Kern her ähnliches führt das David Foster Wallace in seiner Rede „This is Water“ aus (auf die ich dank Christian Spannagel mal gestoßen bin).
Und zur kompletten Verwirrung und damit aber auch zur Möglichkeit, sich bewusst und frei zu der Frage nach Digital und Analog zu verhalten hier noch mal der Text von Kathrin Passig und Aleks Scholz, den ich schon beim Post zur Blogparade von Oliver Tacke verlinkt hatte: Schlamm und Brei und Bits. Oder Warum es die Digitalisierung nicht gibt.
Disclaimer: Je nachdem, aus welcher Perspektive ich blicke, gilt das tertium non datur schon….Und mit Blick auf den Tweet-Absender: Vielfalt halte ich für einen wichtigen Wert, aus vielen Gründen.