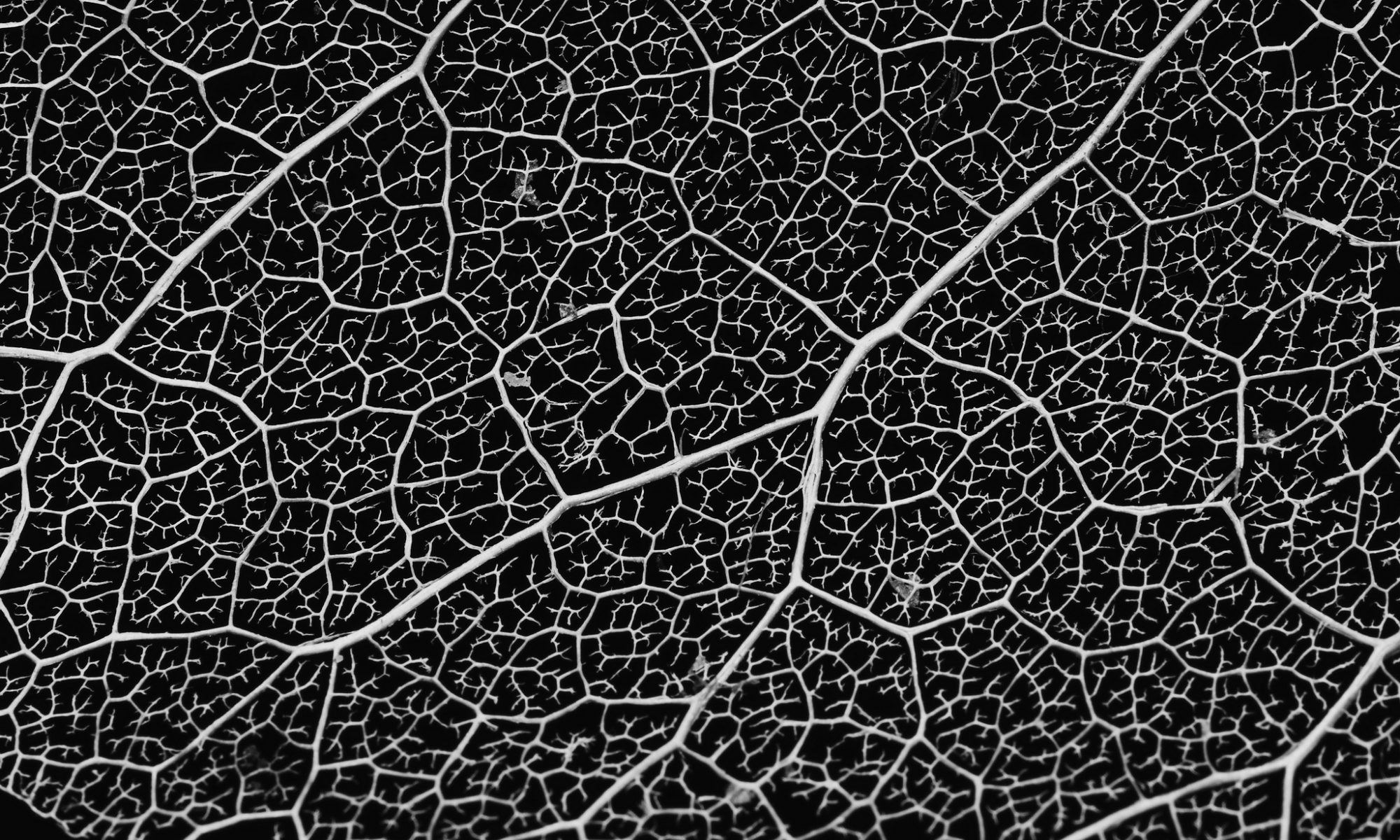Ich konnte einfach nicht mehr. Und das hat natürlich zuallererst mit mir zu tun, weshalb ich jedem und jeder mit anderem Blick auf das Symposium vollstes Interesses und Wertschätzung entgegenbringen möchte und dankbar bin für die Veranstaltung. Und trotzdem. Wir sind nur auf der Oberfläche entlanggeschrubbert. Und wozu das dann wirklich gut sein könnte, hat sich mir nicht erschlossen oder ich konnte nicht die nötigen Resilienz- und Sebstwirksamkeits-Fähigkeiten aktivieren, um das anders zu sehen und mitzugestalten.
Einordnung des Titels (eilige Leser*innen solltens überspringen)
Warum? Der Titel der Veranstaltung weckte bei mir hohe Erwartungen: Eine Verschränkung eines Abwehrenden und eines ermöglichenden Blicks auf KI (trotz und mit), eine Bearbeitung aus den Fächern heraus und dann auch noch als Symposium, das heißt in einer in der Bildungsphilosophie in der Antike bei Aristoteles verankerten Modus (dass Symposium eigentlich auch Trinkgelage heißt, wie einer meiner Lieblingsprofessoren der Literaturwissenschaftler, Herbert Anton, in Düsseldorf nicht müde wurde zu betonen, zeigt vielleicht, dass ich durchaus auch Heiteres und Abgründiges in dem Zugang erhoffen würde).
Fachspezifischer Exkurs
Die Veranstaltung fachspezifisch aufzusetzen, ist ja gleich aus mehreren Gründen sinnvoll. Mindestens aus prüfungstheoretischer und -praktischer Ebene, weil wir Kompetenzen immer mit Ausrichtung auf domänenspezifische Handlungsfelder und gesellschaftliche Herausforderungen denken sollten und sie dabei disziplinär organisieren. Es können also allgemeine Anforderungen an Prüfungsqualität und Kompetenzentwicklung gestellt werden, ob und wie diese eingelöst werden (können), ist aber immer eine fachliche Frage. Ein weiterer Grund ist, dass wir ja meist immer noch von generativer KI, von Sprachmodellen sprechen, die sich einer sprachwissenschaftlichen, pragmatischen Vorgehensweise bedienen, dessen Passung für die Anforderungen in den verschiedenen Fächern ja durchaus kritisch in den Blick genommen werden muss. Hinzu kommt eine Diskurslinie in der Hochschuldidaktik, die ich bei der Frage der Verbindung von fachbezogener Didaktik, Fachdidaktik, allgemeiner Didaktik und Hochschuldidaktik verorten würde (Jahnke & Wildt XXX 2023, Zierer 2016), die aktuell vor allem unter dem Begriff der fachsensiblen Hochschuldidaktik diskutiert wird. Ansätze der Verbindung von didaktischen Fragen und Lösungen aus der sekundären Bildung an den Schulen und den Hochschulen werden immer noch wenig verfolgt.
404 – Systemfehler Bildung not found
Dass die Hochschulen systemisch den Anspruch, Kompetenzentwicklung zu ermöglichen und Orte für Hochschulbildung zu sein, immer noch nicht gut einlösen (können), führte Oliver Reis zu Beginn aus. Ein niederschmetternder Stop-it-Aufruf? Bei gleichzeitiger Notwendigkeit das System Hochschule nicht komplett auszusetzen? Handelt es sich hier im Antinomien, unauflösbare Gegensätze (vgl. Reinmann 2017)? Für mich ist hier wichtig, den Anspruch, den Punkt zu setzen und dann zurückzutreten. Stop. Mein Plan: Dazu nochmals den Beitrag zu Offenheit und Mut zu lesen, in dem Oliver Reis und Inga Kros (2024) die Frage stellt zu welcher Kontingenz Hochschulen fähig sind und das mit Ivo van den Berks Beitrag „Zufällig gute Lehre“ (2023) zu setzen – dann KI als Thema drauflegen. In jedem Fall arbeitet das bei mir weiter, auch zusammen mit dem Impuls von André Baier auf dem Workshop des Stifterverband zum ars legendi Demokratiebildung. Er brach das bisherige Workshopsetting auf, lud zum Stuhlkreis ein und fragte dann, was bisher demokratisch gewesen sei an der Veranstaltung. Theoretische, vermutlich lesenswerte Bezugspunkte (Auszüge aus dem Thesenpapier von André Baier):
- Max Frisch. 25 Fragen an die TU Berlin.
- Fellows für Innovationen in der Hochschullehre. 25 Fragen zur Hochschullehre. 2021 (habe online leider keine Quelle gefunden)
- Jacques Rancìere. Der unwissende Lehrmeister. 2009.
Zurück zum Symposium: In der anschließenden Diskussion hatte ich nicht den Eindruck, dass die prinzipielle Kritik nicht aufgegriffen wurde, schnell setzte man wieder bei einzelnen Prüfungsszenarien mit KI-Einsatz an, die alle von guter Integration zeugten, aber die systematische Frage der Kompetenzorientierung oder gar Bildung im System Hochschule blieb dahinter zurück. Mein Eindruck. Schlagworte / Zitate aus dem Vortrag ansonsten noch nachzulesen bei Mastodon #PrüfKiFach25 – Mastodon. Oder man kann es mit der Ankündigung eines re:publica Beitrag über Schule sagen: 404 – Bildung not found.
Professoren als Götter
Nach der ersten Keynote stiegen Juliane Staubach, Andrea Thiel und Ute Brgenzu zu einer zweiten ein, mit dem wichtigen Rückbezug, dass man ja genau an den Stellen arbeite, die Oliver Reis als Herausforderung benannt habe. Eine Verortung an einer einzelnen Stelle/Bereich im System, die Verantwortungsübernahme durch die Hochschuldidaktik / den third space für diese Herausforderung ist meines Erachtens beeindruckend, aber sogleich muss das systemisch eine Überforderung sein. So wurden in der Keynote dann auch Lösungen gezeigt, die entlang verschiedener Einsatzzwecke von KI, Erklärungen von Studierenden einforderten oder nicht und Empfehlungen zur Verwendung von KI gaben. Eine stärkere Rückkopplung an die Kompetenzorientierung und die Frage der Hochschulbildung, an die Frage von Begegnung von Bildungspartner*innen innerhalb der Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden könnte man – wenn das System Hochschule das fördern würde – als weiterführenden, tiefergehenden Ansatzpunkt nehmen. Das fehlte mir hier eklatant.
Dass dann in dem Beitrag Professoren als Götter bezeichnet wurden, die machen können, was sie wollen, passte zwar zu dem (notwendigerweise verzweifelten) Enthusiasmus in diesem Beitrag im Gegensatz zu der auch als apokalyptisch diskutierten ersten Keynote – aber kann man das wirklich so sagen? Andererseits passen so viel theologische Vibes vielleicht gerade zu dem KI-Thema, irgendwie (siehe auch den bereits von 2023 stammenden Podcast Science Fiction trifft auf Realität). Klassisch kenne ich zu der Rolle, Haltung und Verantwortung von Professoren die Einordnung in das königreich-gleiche Lehrstuhlprinzip (ich dachte bei Wildt, finde es aber gerade nicht), sowie die professionstheoretische Einordnung, in der hohe Freiheitsgrade mit diesem Beruf verbundenen werden, weil in hoher Verantwortung autonom entschieden werden können muss, in einem Beruf in welchem zentrale gesellschaftliche Werte vertreten werden, was mit Mandaten, Lizenzen zu tun hat (Szczyrba 2009).
Wieder Vorlesungen: Promptergebnisse
Wo ich dann gleich zwei Mal – auch körperlich – ausgestiegen bin, war als Promptergebnisse einfach nur vorgelesen wurden. Wir waren also irgendwie dann wieder in der Vorlesung angekommen, zwar mit KI erzeugt, zwar als Ausgangspunkt für nächste Schritte und Interaktionen, aber das fühlte sich dann doch nach einem enormen Performanz-Gefälle an und irgendwie lieblos.
Das erste Mal wurde vorgelesen in einem vom Ansatz aus der kritischen Zukunftsforschung, den ich grundsätzlich total wichtig und richtig empfand. Verschiedene Variablen nach Gewichtung miteinander kombinieren, um mehrere Szenarien zu diskutieren. Ein Ansatz, der dann aber in den ausgeführten, KI-unterstützten Szenarien auch irgendwie beliebig, oberflächlich wirkte. Vielleicht macht es Sinn, die Szenarien nochmal in Ruhe nachzulesen, vor Ort war mein Impuls ein ablehnender.
Das zweite Mal, als mit KI-Unterstützung erzeugte Use-Cases zum Einsatz von KI in Prüfungen aus verschiedenen Fächern vorgestellt wurden, die auf Postern ausgedruckt präsentiert und vorgelesen wurden.
Vielleicht ist es nur eine Ablehnung des künstlich produzierten und dann für eine Rezeption vorgetragenen künstlichen Produkts meinerseits – also ein Vorurteil über die Qualität. Aber mein Eindruck war schon, dass anders erstellte Stories eine andere Qualität gehabt hätten und die Menschen anders in Kontakt und Diskussion gebracht hätten. Letzteres können aber die besser beurteilen, die da noch dabei waren. Ich lass mich gerne korrigieren.
Trotzdem weitermachen, denn KI wird und alle retten, es sei denn…
Das Thema weiter anzugehen, die Perspektiven zu verschränken und gerne auch in einem Symposium bleibt ja trotzdem wichtig. Mehr Zeit, die anwesenden Personen miteinander ins Gespräch zu bekommen und dabei in der Tiefe die fachlichen Anforderungen mit den prüfungstheoretischen zu verbinden, dazu wären weitere Schritte sicherlich sinnvoll. Vielleicht lag es aber auch an mir, ich versuche mich immer wieder auf verschiedenen Wegen mit unterschiedlichem Erfolg dem Thema KI zu widmen, z.T. mit einem mindestens ambivalenten Gefühl, weil ich immer noch nicht den Eindruck habe, dass KI eine Lösung für eines der vielen wirklich drängenden Probleme bietet, die wir haben (siehe auch Vortrag von Matthias Spielkamp KI wird uns alle retten. Es sei denn, sie tut es nicht auf der re:publica24). Sie ist halt jetzt da, und klar, hoffentlich kann man sie gut für etwas nutzen. Update (17.04.) Die Materialien / Folien des Symposiums sind auf der Webseite des Symposiums abrufbar! 🙂 – also gerne nachlesen und sich ein eigenes Bild machen oder meinen Blogbeitrag kritisieren.