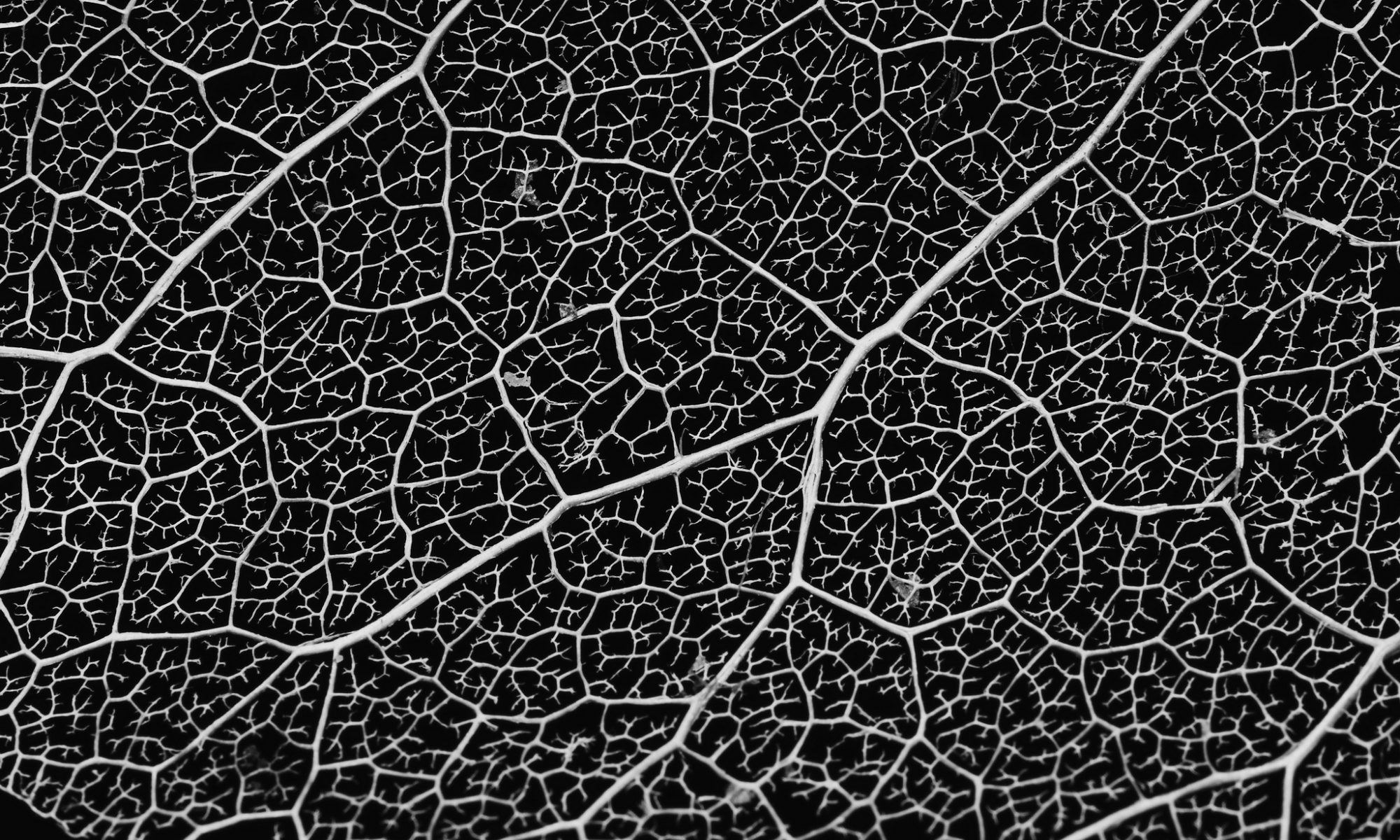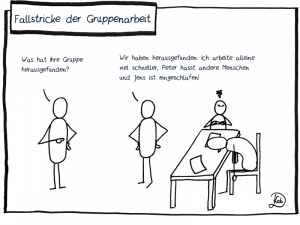Kann man sich die Zukunft wissenschaftlich zu eigen machen bzw. was wären spezifisch akademische Bezugspunkte dazu, habe ich mich gefragt, als ich den impact-Free-Beitrag von Marco Kalz und Gabi Reinmann zu Future Skills zum ersten Mal las. Die Idee kurzgefasst: Sollte man nicht an den akademischen Kompetenzbegriff bzw. an akademisch geprägte Kompetenzen anknüpfen und an die wissenschaftliche Beschreibung und Begründung eines Soll-Zustandes?
Falsch: Einschub – kleiner Textstart mit viel Warterei
Falsch, die erste Reaktion auf den Beitrag war Zustimmung, die zweite ein Stolpern über mir noch unbekannte Begriffe, die mir aber verfolgenswert erschienen. Dann ein erster halbseitiger, gestückelter Textentwurf mit ganz vielen Leerstellen und vor allem mit einem Literaturbezug im Kopf. Da gabs doch was von Gabi Reinmann zur wissenschaftlichen Perspektive auf Ziele…fand den Beitrag einfach nicht. Dann ein kurzer Impuls, Textentwurf schon als Blogbeitrag online zu stellen. Unsicher. Feedback von einem tollen Kollegen eingeholt, der viele Rückfragen und gute Hinweise hatte. Erstmal wieder liegen gelassen. Dafür jetzt aber (Anlass folgt unter der letzten Überschrift)
Worum geht es: Kritische Diskussion um Future Skills, Lerntransfer als Alternative
Marco Kalz und Gabi Reinmann greifen in ihrem impact-free-Beitrag von August 2024 die Diskussion um Future Skills auf und begründen – m.E. sehr gut, nützlich und nachvollziehbar – wozu es hilfreich ist eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit und die theoretische Fundierung von Future Skills zu führen. Das Anschließen an einem Verständnis von Hochschulbildung mit verschiedenen Komponenten, von denen eine „Einsatz, Anwendung und Erzeugung von Wissen“ (S.5) sei und damit eine „zukunftsgerichtete Problemlösedisposition“ entwickelt werden könne, erscheint mir nicht nur schlüssig hergeleitet, sondern auch hilfreich für aktuelle und weiterführende Diskussionen und Entwicklungen.
Als Alternative zu Future Skills, führen Kalz und Reinmann kurz in das Konzept des Lerntransfers ein (Ebd., 2024, S. 5), das ich mir – ehrlich gesagt – weiter anschauen muss. Mir ist der Begriff noch gar nicht untergekommen. Und das obwohl er im Hochschulqualifikationsrahmen bereits angelegt sei (ebd., S. 5 – wohl aber nicht explizit) und ich mich mit Transfer durchaus schon auseinandergesetzt habe, allerdings dort eher von Prüfungsfragen kommend zur Frage des Transfer von Lehrkonzepten und -szenarien im Rahmen der TURN23.
Vielleicht hilft es auch den Klassiker von Mandl zum Trägen Wissen mal endlich ernsthaft aufzuschlagen. Kalz und Reinmann jedenfalls würde ich beim ersten, zweiten und dritten Lesen so verstehen, dass es einerseits um so etwas wie antizipierten Transfer in zukünftige, mögliche Anwendungsfelder geht und andererseits um eine Form von Theoretisierung von Erfahrungen, wenn sie schreiben, dass es „bei den Modalitäten unter anderem um proaktiven und retroaktiven Lerntransfer (Kollhoff, 2021)“ gehe und weiter: „Proaktiver Lerntransfer fördert über Analogien in Problemsituationen eine Disposition zur Problemlösung (Richland & Simms, 2015); retroaktiver Transfer ist als ein nachgelagertes Generalisieren von Einzelerfahrungen in ein übergreifendes Konzept zu verstehen.“ (Kalz und Reinmann, 2024, S. 5)
Integration in die Fachwissenschaft mittels forschendem Lernen und akademischem Kompetenzbegriff?
Außerdem fordern beide, dass Future Skills in die Fachwissenschaften integriert werden sollten. Hier könnte meines Erachtens der akademische Kompetenzbegriff helfen (dazu später mehr) aber auch eine stärkere Ausrichtung auf Forschendes Lernen, das ja gerade fachliche Fragen gemeinsam mit Studierenden zu lösen sucht (in allen Ausprägungen, angefangen bei dem Aufgreifen von Forschungsergebnissen als forschungsbasierte Lehre über die Formulierung von Forschungsfragen bis hin zum gesamten Forschungszyklus). Wieso sollte es nicht möglich und hilfreich sein, gemeinsam mit Studierenden, deren Irritationen, Fragen und Erfahrungen einen disziplinären, forschenden Zugriff auf zumindest Ausschnitte von Problemen zu erkunden? Würden darüber nicht das, was mit Future Skills gemeint ist, auf die Hochschulen eigene Weise in den Blick kommen?
Hilfreich könnte es dabei sein, neben dem Forschenden Lernen als Grundhaltung oder Ausgangspunkt den akademischen Kompetenzbegriff oder wie Wick (2011) sagt, die akademisch geprägte Kompetenzen mit den Überlegungen zur Diskussion um Future Skills zu verbinden. Was hat es mit diesem akademischen Kompetenzbegriff auf sich?
Der akademische Kompetenzbegriff beruht unter anderem auf den Fachgutachten Kompetenzorientierung von Niclas Schaper (2012). Nach Ausführungen zum Kompetenzverständnis in der empirischen Bildungsforschung, der Berufsbildungsforschung bzw. -pädagogik, der Schlüsselqualifikation bzw. -kompetenzen wird dort auf knappen zwei Seiten angerissen, dass „eine akademische Kompetenzentwicklung auf spezifischen Grundlagen, die sie z. T. deutlich von anderen Bildungskontexten abheben und dadurch ein spezifisches Profil akademisch bzw. wissenschaftlich geprägter Kompetenzen konstituieren [basiert]“ (ebd., S. 22f.). Für diese Kompetenzen formuliert Wick (2011, S. 5), dass sie „von der Qualität und grundlegenden Entwicklung
- Reflexiv, 2. Explikationsfähig, 3. Erkenntnisbasiert
und von Inhalt und Zweck her, 3. Disziplinär organisiert, 4. auf komplexe, neuartige Situationen und Aufgaben bezogen sowie 5. Tätigkeitsfeldbezogen“ seien. Mit leichten Unterschieden rezipieren das auch Reinmann (2015), sowie Reis (2014, S. 27) und Schaper (2012). Passend zum akademischen Kompetenzbegriff skizziert Marco Kalz in seinem kürzlich erschienenen Beitrag zur Kompetenzorientierung nicht nur die historische Diskussion zum Thema Kompetenzorientierung für die Hochschulen, sondern betont auch mit Bartosch et al. (2017, S. 9) die „Fähigkeit zu reflexivem und innovativem Handeln auf der Basis von wissenschaftlicher Generierung von Wissen und kritischer Wissensanwendung“ als Gegenstand oder Ziel des Kompetenzerwerbs an Hochschulen (Kalz, 2025, S. 5).
Weiterentwicklung zu Kompetenzen und Outcomes
Meiner Ansicht nach liegt es hier auf der Hand, dass die mit den Future Skills verfolgten Ziele gut in einer ernsthaften Auseinandersetzung mit diesem Kompetenzverständnis aufgehen könnten. Der akademische Kompetenzbegriff scheint allerdings im Vergleich zu anderen Modellen noch wenig verbreitet und müsste z.T. noch weiterentwickelt (vgl. Reis 2014, S. 86; vgl. Wildt 2010, S. 67) und vor allem hinsichtlich der praktischen Aufnahme und Umsetzung untersucht werden. Gleichwohl ist der akademische Kompetenzbegriff Referenz der strategischen Leitlinien für Studiengangentwicklung der TH Köln (2018, S. 4), vielleicht auch an anderen Orten in Verwendung – das sollte sich herausfinden lassen.
Auch Kalz (2025) zeigt zur Kompetenzorientierung sowohl Verbindungslinien verschiedener Konzepte und Prinzipien als auch Wege auf, die noch weiter ausgearbeitet oder ausgeführt werden müssten. Eine Leerstelle, die er unter Bezug klar benennt: „Während sich Lernergebnisse auch allein auf Wissen beziehen können, müssen Kompetenzen dem Autor [Tenberg (2014)] folgend über diese hinausweisen und auf ein Können in Anwendungssituationen verweisen.“ Diese falsche Gleichsetzung von Lernergebnissen und Kompetenzen geschehe „z.B. im „Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse“ (QDH) (KMK, 2017)“ (Kalz, 2025, S. 2). Nur von welchen Outcomes mit welcher Struktur und welchem Anspruch ist hier genau die Rede? Eine Formulierungsstruktur von Outcomes, wie sie bspw. Oliver Reis (2014) erarbeitet hat, scheint mir zwar die Differenz zwischen Kompetenzen und Outcomes nicht aufzulösen, aber in einen Lösungsansatz zu überführen. Die „Was-Womit-Wozu-Struktur“ (Reis, 2018) formuliert immer auch den außerhalb der Prüfung liegenden Sinnhorizont der geprüften Handlung, und greift damit auch die Notwendigkeit auf, über die Prüfungssituation hinaus zu denken und zu handeln, indem an „Bildung als notwendigen Horizont von Kompetenz“ (Reis 2014, S. 67) und vermutlich auch an „Bildung als Zielhorizont von Lernen“ (Reinmann 2016, S. 3) angeknüpft werden kann. Mit dieser Operationalisierung ist meines Erachtens also immer auch eine bewusste Reflexion dazu verbunden, dass die Prüfung nicht die aus dem Zusammenspiel von Hochschule, Individuum und Gesellschaft resultierenden Erwartungen vollständig einlösen kann und darf, aber die dortigen Schließungen mit bewussten Öffnungen verbunden vielleicht die Wahrscheinlichkeit für weniger Zufälligkeit in der Bildung erhöhen kann.
Den Soll-Zustand wissenschaftlich beschreiben und entwickeln
Versteht man die Herausforderungen der Hochschulen so disziplinär, erkenntnisbasiert und generell wissenschaftlich, ließe sich eine weitere Perspektive sinnvoll nutzen, die Gabi Reinmann in ihrem Beitrag „Mögliche Wege der Erkenntnis in den Bildungswissenschaften“ aufmacht: Forschung als Problemlöseprozess kann den Ist-Zustand beschreiben und erklären, den Weg beschreiben und entwickeln und den Soll-Zustand beschreiben und begründen (Reinmann, 2009, S. 4). Löst man sich – soweit das möglich ist – von der bildungswissenschaftlichen Ausrichtung dieser Perspektive und prüft jeweils, inwiefern innerhalb der Lehre in der eigenen Disziplin der Blick auf den Soll-Zustand eingenommen werden kann oder mit welchen weiteren Disziplinen gemeinsam eventuell sogar im forschenden Lernen die zukunftsgerichteten Problemlösedispositionen erkundet werden können, wäre das meines Erachtens ein großer Gewinn für die Zukunft der Hochschulbildung.
Nachklapp und Anlass
Ich denke für einen Blogbeitrag kann man so wie oben arbeiten und argumentieren. Für eine Publikation würde ich an der ein oder anderen Stelle versuchen, Spezifika und Trennschärfen zunächst weiter auszubauen und darzustellen, bevor die Synthesen angegangen werden. Als Startpunkt müsste es funktionieren. Der Anlass, jetzt den Beitrag zu verschriftlichen war der Call der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft zum Thema Studiengangsentwicklung. Ich denke, dass ich durchaus den ein oder anderen Aspekt aus diesem Blogbeitrag für das „Kapitel 1: Theoretische Grundlagen der Studiengangsentwicklung“ einreichen könnte. Ich denke aber Future-Skills wird es nicht werden…
Literatur:
Kalz, M. (2025). Kompetenzorientierung. In: Pasternack, P., Reinmann, G., & Schneijderberg, C. (Hrsg.) Handbuch Hochschulforschung. Wissenschaft zu Forschung, Lehre und Hochschulorganisation. Baden-Baden: Nomos Verlag. Preprint online unter: https://osf.io/trv8j/download
Kalz, M. & Reinmann, G. (2024): Erneuerung der Hochschule von Außen nach Innen oder umgekehrt? Kritische Diskussion und Alternativen zur Future-Skills-Bewegung. Impact Free 57 (August 2024). Online verfügbar unter: https://gabi-reinmann.de/wp-content/uploads/2024/08/Impact_Free_57.pdf
Reinmann, G. (2009): Mögliche Wege der Erkenntnis in den Bildungswissenschaften. Buchbeitrag in Jüttemann & Mack („Konkrete Psychologie“) Preprint Januar 2009. Online verfügbar unter: https://gabi-reinmann.de/wp-content/uploads/2009/01/bildungsforschung_preprint_jan09.pdf
Reinmann, G. (2015): Prüfungen und Forschendes Lernen. In: H. A. Mieg & J. Lehmann (Hrsg.), Forschendes Lernen: Programmatik und Praxis. Preprint online verfügbar unter http://gabi-reinmann.de/wp-content/uploads/2014/12/Artikel_Pruefungen2_ForschendesLernen_Dez14_Preprint.pdf
Reinmann, G. (2016): Gestaltung akademischer Lehre zwischen Fall-, Problem-, Projekt- und Forschungsorientierung. Redemanuskript Juni 2016. Online verfügbar unter: http://gabi-reinmann.de/wp-content/uploads/2016/06/Vortragsmanuskript_Zuerich_Juni2016.pdf [08.04.2017].
Reis, O. (2014): Systematische Theologie für eine kompetenzorientierte Religionslehrer/innenausbildung. Ein Lehrmodell und seine kompetenzdiagnostische Auswertung im Rahmen der Studienreform. Univ., Diss. Zugl.: Bochum, 2013. Berlin: LIT (Theologie und Hochschuldidaktik, 4).
Reis, O. (2018). Lehre und Prüfung aufeinander ausrichten. DUZ-Magazin. Online verfügbar unter: https://www.th-koeln.de/mam/downloads/deutsch/hochschule/profil/lehre/duz0318_praxis_alignment_reis.pdf
Schaper, N. (2012): Fachgutachten zur Kompetenzorientierung in Studium und Lehre. Unter Mitarbeit von O. Reis, J. Wildt, E. Horvath und E. Bender. Hg. v. HRK. HRK. Online verfügbar unter https://www.hrk-nexus.de/fileadmin/redaktion/hrk-nexus/07-Downloads/07-02-Publikationen/fachgutachten_kompetenzorientierung.pdf
Wick, A. (2011). Akademisch geprägte Kompetenzentwicklung: Kompetenzorientierung in Hochschulstudiengängen. Heidelberg: HeiDOK. Online verfügbar unter: http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bsz:16-opus-120014
Wildt, J. (2010): Kompetenzen als (neue) Zielsetzung hochschulischer Ausbildung. In G. Terbuyken (Hrsg.), In Modulen lehren, lernen und prüfen. Herausforderung an die Hochschuldidaktik. (S. 53–79). Rehburg-Loccum: Evangelische Akad. Loccum (Loccumer Protokolle 78/09).