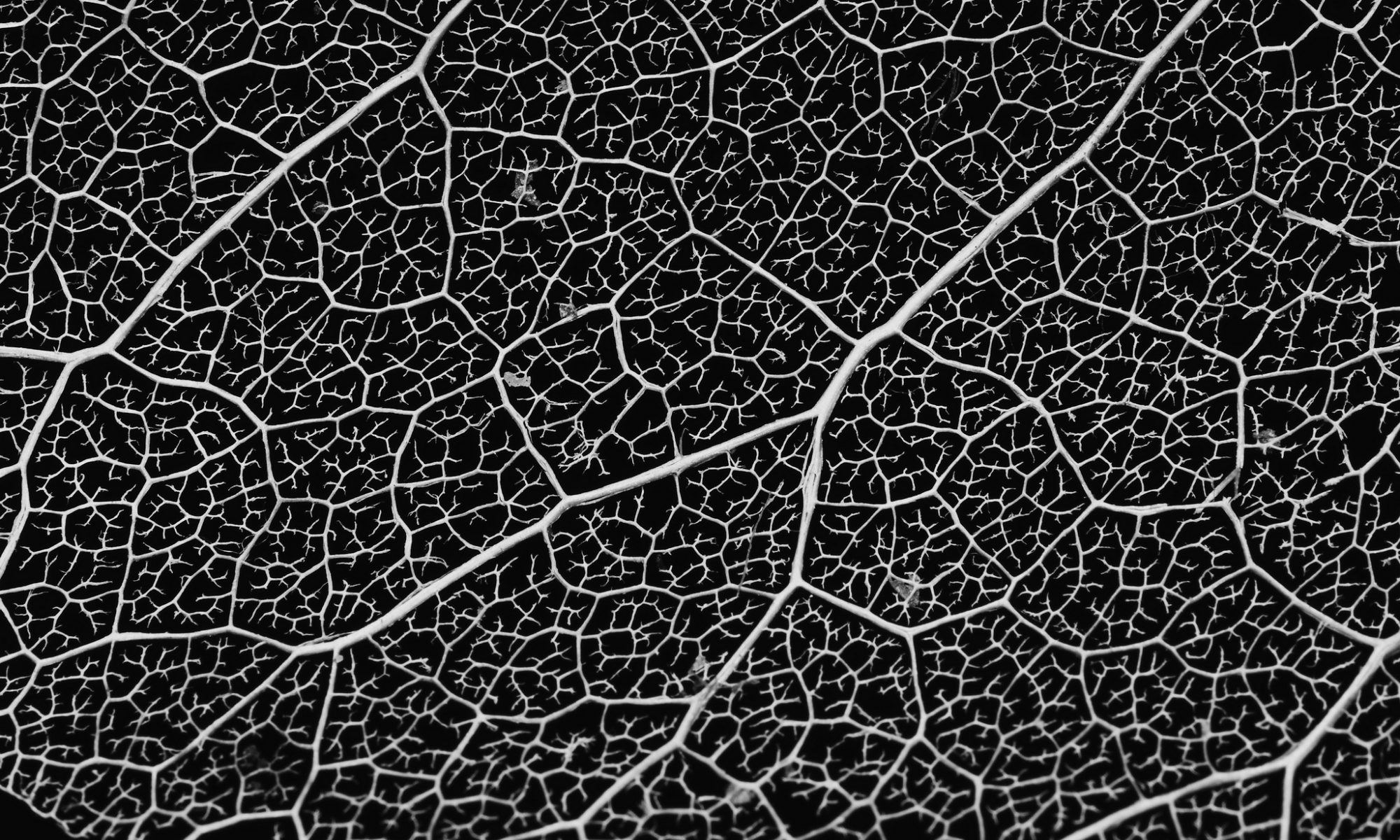Geht es Euch auch so? Bei der Diskussion zu Prüfungen stören mich (bei letzten Gelegenheiten) immer wieder zwei Punkte, die ich hier kurz in einem Schreibfluss sortieren möchte. Der Text mag an ein oder anderen Stelle etwas sperrig sein, das liegt daran, dass es noch eine Selbstklärung ist. Es brauht also sicherlich eine zweite Version, aber vielleicht kann auch jemand mit der ersten Version schon was anfangen, einsteigen und weiterführen oder widersprechen. Der Text ist also ein Versuch. Wenn er ein Essay werden oder sein könnte, würde mich das sehr freuen. Dazu fehlt aber auch noch einiges.
Es geht um Diagnostik, Produkte und Prozesse im Zusammenhang mit Prüfungen.
Prüfen wir Prozesse oder Produkte?
Wenn es darum geht, Kompetenzen zu prüfen oder genauer kompetenzorientiert zu prüfen, dann müssen Lernprozesse eine Rolle spielen. Die zentrale Frage ist: Was ist das Prüfungsobjekt, was ist der Prüfungsgegenstand oder das Messobjekt? Wie manifestiert sich eine Handlung, von der dann wieder auf erworbene Kompetenzen geschlossen werden kann? Dies ist wichtig, um einerseits die Lernprozesse mit Fehlern und Wiederholungsschleifen, neuen Anläufen etc. nicht direkt durch eine Einbindung in die Prüfungsleistung zu instrumentaliseren, nicht jede Lernhandlung ist Teil der Prüfung. Andererseits brauchen die Produkte, die in der Prüfung zur Leistungsmessung herangezogen werden eine innere Struktur, die auf Prozesse angewiesen ist. Theoretische und methodische Herangehensweisen mussten am Gegenstand erprobt, auf ihn angepasst, mit der eigenen Verantwortungsübernahme durch das lernende Individiuum verbunden werden – und sich im Produkt niederschlagen. Das ist mit Situationen, die den Vollzug der zu erwerbenden Handlungsfähigkeit der Studierenden direkt beobachten, vielleicht naheliegender und in Zeiten von KI einfacher zu bewerkstelligen. Doch auch hier muss deutlich sein, dass vor dieser vielleicht als Performanz, Probehandeln, Labor, Experiment, Projekt zu bezeichnenden Situation Ressourcen im Lernprozess miteinander verbunden werden mussten, damit nicht einfach nur ohne vorheriges Lernen improvisiert wird oder Standard-Antworten und -Handlungen aufgerufen und gezeigt werden.
Wo starten wir und wer sind wir?
Wenn ich ein bestimmtes Ziel erreichen will, kann es hilfreich sein, den Ausgangspunkt und den Weg dorthin zu wissen. Wir reden in der Kompetenzorientierung meines Erachtens viel über das Ziel, weniger über den Weg und sehr wenig über den Ausgangspunkt – oder genauer die Ausgangspunkte. Um Studierenden die Steuerung ihres Lernprozesses zu erleichtern, sollte das Ziel (besser das Outcome) und die damit verbundenen Qualitätskriterien (Nivestufenmodell, Kriterienraster, rubric) transparent sein. Wenn dazu noch wenigstens Ansätze vorhanden sind, zu erheben oder zu relfektieren, von wo man (unterschiedlich) startet, ist das für Studierende und Lehrende doch eigentlich ein elementares Wissen zur Gestaltung der Lehr- und Lernsettings und der Schritte auf dem Weg zum Ziel. Das heißt wir können uns über diese Diagnostik (ein großes Wort für Ansätze, die meist in der Hochschullehre nur unterkomplexe erste Ansatzpunkte sein können) klar werden, mit welchen Erwartungshaltungen, Vorannahmen, Wissen, Kompetenzen gemeinsam begonnen werden kann.
Möglicherweise ist diese Verbindung von Start, Weg und Ziel aber auch in der Hochschuldidaktik manchmal besonders herausfordend, weil….welche Prüfungen habt Ihr in hochschuldidaktischen Weiterbildungen und Workshops bislang erlebt, gestaltet oder bestanden? Viele wird es da vermutlich nicht geben, aus verschiedensten Gründen. Aber das ist eine andere Geschichte.